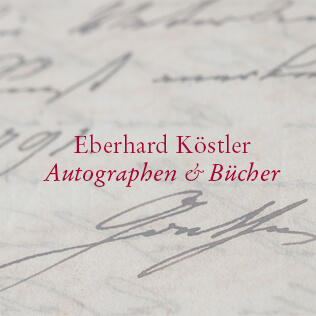Beschreibung
Äußerst umfang- und inhaltsreiche Jugendbriefe des 16- bis 25-jährigen Schülers und Studenten Petzet in gedrängter Schrift an seinen Mitschüler am Gymnasium in Hof, den Philologen Iwan (von) Müller (1830-1917). Christian Petzet konnte das Studium der Staatswissenschaften in München und Leipzig infolge finanzieller Schwierigkeiten nicht beenden, ging dann als Erzieher nach Warschau und gründete 1859 die deutschsprachige „Warschauer Zeitung“. 1876 wechselte er zur „Allgemeinen Zeitung“ nach Augsburg, wo er bis 1896 Hauptschriftleiter war. Er veröffentlichte u. a. „Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840-50“ (1903). Sein Nachlaß befindet sich in der Staatsbibliothek München. – Hier nur einige kurze Kostproben (Volltranskriptionen, die möglicherweise als Vorstufe für eine Veröffentlichung dienen können, stehen zur Verfügung): Brief 1: Hof, 20. November 1848: „[…] Wie gefällt denn dirs in Erlangen? […] Du wirst dich doch etwas mehr in die politischen Umtriebe gemengt haben? – Es ist wahrhaftig nothwendig, daß alle Leute von Talent und Einsicht sich einen klaren Blick in die Verhältnisse und ein Herz fürs Volk anschaffen. Wenn man von solchen Greuelthaten hört und liest, wie sie z. B. in Wien geschehen, wenn man die scheußliche Ermordung des Robert Blum, dem wir, wenn wir Körner wären, mit Kuß den Beinamen pater patriae geben könnten bedenkt, (die die Rache des Himmels auf solche Hunde herabruft, wie sie in Osterreich gegenwärtig obenanstehen; die weit mehr alles menschliche Gefühl mit Füssen tritt, als Polens [?] und Hofers Fall), wenn man bemerkt, wie ein Schnapsbruder in Königsgestalt, ein auf den abgeschmacktesten Ideen festgerittener Friedrich Wilhelm mit Manteuffeln und Brandenburgen und einer hirnverbrannten, hyper-aristokratischen Camarilla und einem blinden Werkzeug wie Wrangel sich mit aller Kraft anstrengt, das Leichentuch der Freiheit von Wien auch nach Berlin auszuspannen, wie sich ein preußischer Abgeordneter ausdrückte und wie das offenste Recht des Volkes mit Füssen getreten wird: – dann muß man mit Ingrimm die Mörder verfluchen und mit aller Anstrengung darauf hinarbeiten, daß das Nationalgefühl und noch mehr das Bewußtsein der freien Menschenrechte in jedes Bruders Brust zum Durchbruch komme, damit wir, wenn unsre Stunde da ist, uns ordentlich wehren und vielleicht einmal, nach langem Sehnen, dereinst als Deutsche auch eine That thun können. Dann muß mit heiligem Eifer zur Fahne der Freiheit, der Volksherrschaft schwören und für die Ideen der Demokratie Propaganda machen, wo man nur empfängliche Gemüther findet! In Hof thun wir Demokraten das Mögliche […] Brief 2: Hof, 23. Januar 1849. „[…] Es ist eine traurige Zeit, in der wir leben, doppelt traurig, weil sie uns so viele schöne Hoffnungen, die wir in der Brust getragen hatten, vollkommen zu zerschlagen scheint. Das Volk hat seine Unfähigkeit bewiesen, die Resultate der freien Wissenschaft, das System der Freiheit, ins Leben einzuführen. Niemand hätte im März, April, Mai des vorigen Jahres daran gedacht, daß auch dieses Mal noch das Volk besiegt und Wahrheit und Freiheit zurückgedrängt und abgewiesen werden könnten; im Gegentheil hegten die Freien die Hoffnung endlich einen dem Zeitbewußtsein entsprechenden Staat erstehen zu sehen und die Sklavenseelen zogen sich schon zurück und fürchteten sich vor dem Blitz der Vernichtung, den das erwachte Deutschland auf sie herabsenden würde. Und dennoch ist das Volk wieder jämmerlich betrogen, seine Freiheiten werden ihm eine nach der andern entrissen oder mindestens verkümmert, seine hervorragenden Freunde werden erschossen oder erhenkt oder versiechen hinter nassen Kerkermauern; die Fürsten blähen und brüsten sich wieder und sehen mit einem Stolz wie nie zuvor auf das mit Füssen getretene Volk herab; und die erbärmlichen Sklavenseelen, denen der Geldsack und der Bauch ihr Gott ist, und die sich im März zu drücken für nöthig fanden, stolziren jetzt wieder hohnlachend durch das gebeugte Volk. Im März war die Zeit angebrochen, wo Alles fallen mußte, was schlecht war, wo das Stündlein für jeden Frevler an der Menschheit schlagen mußte – wenn es anders mit Deutschland doch noch etwas hätte werden sollen. Die Zeit ist vorüber und unwiederbringlich verloren. Unwiederbringlich? Ist es nicht möglich, daß sich das Volk noch zu glorreicheren Thaten erheben könne? – Ich wünsche es sehnlichst, aber ob mein Wunsch nicht etwas Unmögliches zum Gegenstand hat – wer bürgt mir dafür? Das Volk selbst? – Wir? – Die Freunde der Freiheit, denen ich mich zugeselle an Entschiedenheit des Willens, wenn auch meine Kräfte noch schwach sind, diese bemühen sich zwar, das Volk über sein Interesse aufzuklären und seine Bildung eifrigst zu befördern, diese Bemühungen werden auch an vielen Orten von gutem Erfolge begleitet; aber wie häufig wird nicht auch die Erfahrung gemacht, daß elende Pfaffen und niederträchtige Büreaukraten durch Terrorismus ihren Ansichten bei ihm nicht vergeblich versuchen Geltung zu verschaffen; bis die Gewalt der Waffen, dieses bluttriefenden Mittels sehr oft der Rohheit und Gewaltthätigkeit das Volk ganz wirksam belehrt über unsre Zustände […] Meinst du nicht selbst, daß unter der halben Million, die voraussichtlich in diesem Jahr aus Deutschland nach Amerika wandert, ein guter Theil von Deutschlands Intelligenz einmal und zweitens seines Reichthums, der ja nicht nicht so gar groß mehr ist, dem Land der Freiheit zugeführt, dem lieben Vaterland aber entzogen wird? Gewiß. Und so wirds fortgehen. Die Demoralisierung, die von der Willkürherrschaft beabsichtigt wird, um das Volk ungestört knechten zu können, ist erwiesen; und das ist eine sehr ernste Sache. Unser Volk kommt nicht vorwärts in seiner Bildung. Das Verdummungssystem unsrer Pfaffen hat seine Macht noch nicht verloren. Mit dem Falle der Bildung unsres Volkes wäre seine Existenz entschieden. Die drohendste Seite aber, die Deutschland zeigt, ist die materielle. Der Pauperismus greift immer um sich und wer ihn verschuldet, darüber herrscht bei Denkenden kein Zweifel; die Armuth durchzieht Deutschland und weiht das ganze Land zu ihrem Eigenthume; und Brot, der Ruf um Brot wird es sein, was das deutsche Volk noch härter an einander bringen wird, als je der Kampf um geistige Besitzthümer […] Der Eisgang. Ich stand auf hoher Bergeshalde / Und sah hinab ins weite Land Bis fernher bei dem düstern Walde Am Horizont die Erd entschwand; Die Sonne sandte frische Strahlen Herunter auf des Stromes Dach Bald donnernd springen alle Schalen, Es drängt und treibet allgemach. / […]“ Ein Loblied auf München Brief 3: München, 2. Juli 1849 „[…] in jeder andre Beziehung ist München [gegenüber Erlangen] entweder gleich oder überlegen. […] In der Staatsbibliothek, die weit über eine halbe Million Bände zählt (man gibt sogar 700 000 an), stehen dem Studierenden Hilfsmittel zu Gebote, wie man sie in Deutschland nur in Berlin besser und vollständiger finden kann. Man kann alle seine Wünsche befriedigen und hat keinerlei Unbequemlichkeit dabei und braucht – was auch viel werth ist -Niemand was zu danken […] Das ganze Concert bestand zwar nur aus fünf Vorträgen, aber ich habe außer einigen Opern im Hoftheater noch nichts Beßeres gehört […] Die Produktion fand, beiläufig bemerkt, im Odeon statt, wo auch ein Lesekabinet von der vielseitigsten Ausbreitung einen Sammelplatz der Münchner gelehrten Welt bildet. Schon den Regimentsmusiken und der beßern hiesigen Musikgesellschaften hört sich gut zu; aber im Theater erst kann man was Ausgezeichnetes hören. Das Orchester ist ungefähr sechzig Mann stark, worunter ein gut Drittel Violinvirtuosen. Sonntag und Donnerstag sind Operntage. Die Oper ist hier verhältnißmäßig nach dem Urtheil der Kundigen das Beste vom Theater, obwohl Ballet und Schauspiel auch wenig vermissen laßen […] Das Beste aber hörte ich gestern, den Don Juan, das unübertroffene Meisterstück Mozarts […]“ Brief 4: Hof, 17. Januar 1851. […] Seit den dritthalb Jahren, die hinter unserer Schulzeit liegen, habe ich viel gebummelt, wenig studiert. Meine Kraft habe ich auch nach dem Absolutorium zum sehr großen Theile den verzogenen Kindern reicher Leute geopfert, um mich drei Semester durchzuschlagen. Kaum der Schule entlaßen wurde ich halb gezogen, halb warf ich mich in politische Studien und Diatriben, welche bei der zwar nicht extremen, aber ziemlich entschiedenen Richtung, der ich nun auch äußerlich anzugehören anfing, hauptsächlich dadurch nicht zu meinem Nachtheile, weder innerlich noch äußerlich, gereichen konnte, weil ich den Vortheil, vielleicht darf ich sagen: das Glück hatte, dieselben unter steter Aufsicht und Führung unsers erfahrenen und tiefgelehrten Profeßors Wurm durchzumachen, der mir namentlich zu Aufsätzen und Referaten für unser Volksblatt die Anleitung gab und ein stets mit Vertrauen und einer vielleicht zu reichlich bewiesenen Achtung entgegenkam. Ich habe ihn später in seinem Gefängniße besucht und ein halb Jahr darauf die Freude erlebt, ihn in München wieder zu finden, wo ich dann oft aus seinem Hause mir Rath und Lehre holte […] Mein Studentenjahr 1849 auf 50 war getheilt in die Bekanntschaft mit der Stadt und ihren Kunst- und Bildungsanstalten; mit der Gesellschaft des Volkes, einiger befreundeten Studenten und einer adeligen Münchner Familie, die mir des Guten viel erwies, mit literarischen, historischen, ästhetischen Studien; mit forialen [?], juristischen und anderweitigen Kollegien, mit einem kranken Fuße und einem schmalen Geldbeutel, der mir noch mehr Sehnsucht nach der Heimat beibrachte als ich vonnöthen gehabt hätte und mit unnützen Träumen und Fantasien, jugendlichem Weltschmerz, Lieben und nicht wissen wen aus derlei albernem Zeitverderb, der einzog, sobald die Politik ausgezogen war […]“ Leipzig ist ein Nest … ein schwächliches Miniaturgebilde Brief 5: Leipzig, 19. Mai 1851. „[…] Leipzig ist ein Nest, das, abgesehen von der Universität, mit München in Nichts den Vergleich aushält. Es hat nicht einmal ein einem Gebirgssohne trinkbares Wasser. Was aber 16 Jahr an Menschen ist, sieht in der Regel verblüht aus. Zwei Drittheile der weiblichen Bevölkerung sind, so wird behauptet Dohlen von den verschiedenen Abstufungen. Die Kinder allein sind hübsch, aber schon zu viel geschliffen. Gemüth ist dem Haufen fremd. Rohes Tragenthum [?] und rohe Sinnlichkeit überwiegen. In der innern Stadt, wo ich wohne, (Neumarkt Nr. 30,) ist jeder Raum benutzt. Alles zusammen gedrängt, Alles voll Leben und furchtbarem Lärm, besonders natürlich jetzt, solange die Messe dauert. Die Ausstellungen in den Kaufläden sind oft prachtvoll, eigentliche Kunstausstellungen und Sammlungen wie in München gibt es bis auf ein paar kleine weiter nicht. Für Musik ist gut gesorgt, sie wird aber wie mir scheinen will, weniger mit Verstand geübt und geliebt als zur Unterhaltung so obenhin. Von der Natur ist Leipzig ziemlich verlassen, das Rosenthal ist gegen den englischen Garten ein schwächliches Miniaturgebilde. Die Stadt besteht wie alle neueren Städte aus einem alten engen Innren und schönen modernen Vorstädten. Alles in Allem ist aber Leipzig keineswegs groß […] Brief 6: Leipzig, 26. Oktober 1851. „[…] Ich habe vernommen, daß du die Stelle als Mathematiklehrer aushilfsweise übertragen bekommen hast und werde mich stets freuen, wenn du glaubst deinen ernsteren Studien ein halbes Stündchen abbrechen und mit mir plaudern zu dürfen. Du weißt daß ich auf deine Ansichten und Forschungen größtes Gewicht lege und wie lieb mir insbesondere die Mittheilungen sind, die du mir aus deiner Wissenschaft und der Theologie von Zeit zu Zeit gemacht hast […]“ Brief 7: München, 20. Mai 1853. „[…] Gott sei Dank, lebe ich hier in einem Kreise hochgebildeter Menschen, wie man sie selten findet. Dieser Umstand, der mich noch mehr den Gegensatz meiner Lage hatte fühlen, mich noch stumpfer hatte verzweifeln lassen, hat mich gerettet. Ich konnte mich nicht so ganz verstellen, daß eine an mir den mütterlichsten Antheil nehmende Dame sich nicht bemüht hätte, durch einen mir sehr nahe stehenden Freund den Grund meiner Verdüsterung zu erfahren. Ganz eigenthümliche, ganz romantische Umstände und Zufälle machten von meiner Seite Mittheilung über meinen Zustand möglich. Doch war ich so tief bereits in jenem seelischen Verfall verloren, daß ich schon entschieden die liebevollsten Anerbietungen verworfen hatte, und nur den täglich fortgesetzten Bemühungen jenes Freundes gelang es, mich davor zu bewahren, mein endlich gefundenes Glück nicht eigensinnig von mir zu stoßen […]“ Der gerade gekrönte Plunder Brief 8: Rügheim, 8. August 1853. „[…] Du siehst zu trüb, mein Lieber! Ich begreife recht wohl, wie ein rastloser und hochbegabter Geist wie der deine nicht das Gefühl träger Selbstzufriedenheit, ja nicht einmal das der Beruhigung bei erfüllter Pflicht kennen mag, ich finde es natürlich, daß er sich täglich höhere und fernere Ziele steckt und seinem innersten Wesen nur durch stetes Wachsthum genügen kann […] Unser Prof Wurm hat einen harten Straus mit zwei sich selbst, für die ungeheure Mehrzahl mit vollem Recht, zu den ’schönsten Zierden der deutschen Wissenschaft‘ zählenden Gelehrten, den Brüdern Grimm, begonnen. Wer Wurms beide Brochüren (erschienen bei Kunz in München) liest, wird über sein gutes Recht dazu nicht zweifelhaft sein. Freilich trotz aller Lessingomanie, mit der unsre Kritik vielfach prunkt, ist die Wahrheit noch heute riskirt, ganz absonderlich, wenn es genuinen ‚Größen‘ gilt […]“ Brief 9: Warschau, 23. Januar 1856. „[…] Traurige und glückliche Veranlassungen in meiner Familie haben meine ökonomische Selbständigkeit, die Schuldenfreiheit, etwas länger als erwartet verzögert, doch bin ich seit langer Zeit aller dergleichen Verpflichtungen ledig und frei. Auch bin ich inzwischen durch die hiesigen Verhältnisse abermals in neue Richtungen gedrängt worden und habe namentlich der französischen und polnischen, auch der englischen Sprache viel Mühe und Zeit gewidmet, wodurch ich wieder auf den einstigen Ausgangspunkt meiner Studien: die Sprachen – zurückgekommen bin. Jedoch habe ich hier daneben auch in der Statistik und Geografie sowie auch in der Nationalökonomie meine Kenntnisse erweitert und passe noch ebenso gut zu einem Zeitungsschreiber als zu einem Sprachlehrer und Erzieher […] Daß ich hier viel Zeit auf lebende Sprachen, namentlich Französisch und Polnisch verwendete, muß ich dir doch etwas näher erklären […] Außerdem hat man hier auch Gelegenheit, Italienisch zu hören, da die Oper und die meisten Zuckerbäcker italienisch sind. Die nothwendigste Sprache jedoch für den gebildeteren Deutschen dahier ist die französische; sie ist ihm nöthiger als selbst die polnische, ohne die man durchkommen kann. Ich trieb also vor Allem fleißig Französisch, bis ich so weit war es leidlich zu sprechen. Dann aber nahm ich das Polnische auf, weil ich es für Pflicht halte, die Sprache des Volkes zu lernen, unter welchem ich lebe […] Die polnische Sprache nämlich, wie alle slawischen, hat von unsrer germanischen und romanischen eine so gänzliche Verschiedenheit, einen so abweichenden Charakter und namentlich auch eine so schwierige Aussprache, daß ihr Studium für den Fremden anfangs fast blos Abschreckendes hat. Lernt man sie aber einmal, wenn auch mit großer Mühe, etwas näher kennen, so zeigen sich bald für den Höhergebildeten so lohnende und einladende Seiten, daß man sich gerne in sie vertieft […]“ Brief 10: Warschau, 11. Mai 1856. „[…] Ein zweites Mittel, mit der Wissenschaft auf dem Laufenden zu bleiben, sind mir die Briefe, welche ich namentlich von Vocke [?], Lossow und meinem Bruder Heinrich erhalte. Da aber Erstre vorzüglich nur die Rechts- und Staatswissenschaft, ein Pastor aber nur Theologie bearbeiten, so würdest du mich durch Mittheilungen aus deinen Fächern, die Filologie und Filosofie, aufs Innigste verpflichten. Wenigstens bitte ich dich mir über die bedeutendsten Erscheinungen dieser Literaturzweige mir manchmal zu berichten. An Bomhard hast du ja jedenfalls eine vollständige Vermittelung mit dem Leben auf diesen Gebieten. Was ich in der Allgemeinen Zeitung – die mir hier von hohem Werth ist – und im Buchladen finden kann, ist hier fast meine einzige Nahrung. Doch bekam ich neulich auch Bunsens Zeichen der Zeit [ = Christian Karl Josias von Bunsen, Die Zeichen der Zeit, Leipzig 1855] samt der zwei Erwiedrungsschriften von Stahl und dem ungenannten katholischen Finsterling zu lesen. An Bunsen finde ich wenig auszusetzen, nur sein Unsterblichkeitsbegriff, den Stahl aus Hippolyt anzieht, ist wol vag und falsch. Besonders scheint er mir mit Würde und Sicherheit das zu vertreten, was ächte Protestanten denken und wollen, was wissenschaftliche Männer, die von der Wahrheit des Christenthums, zugleich aber auch vom Lichte rechter Vernunft durchdrungen sind, längst zu ihrem Bekenntniß gemacht haben, was daher auch das Recht Gottes wahrhaft fördern muß […]“ Brief 11: Warschau, 23. September 1856. „[…] Daß die Eritis sicut deus eine höchst ärgerlich Erscheinung war, finde ich sehr natürlich; mir war es auch eine solche. Aber du überschätzest gewiß die Wirkung dieses Romans, wenn du sagst, er habe bei den Gebildeten nicht nur die Hegelische Filosofie um den letzten Rest von Respekt gebracht, sondern sogar einen wahren horror vor allem Spekulatieren hervorgerufen. Dazu ist die Verfasserin – hat nicht eine Frau das Werk geschrieben? – doch zu schwach gewesen, trotzdem sich ihr bedeutende filosofische und theologische Kenntniße und einige Gewandtheit in der Dialektik nicht absprechen lassen. Ich weiß zwar nicht, wie das Buch in Deutschland aufgenommen worden ist, blos daß es in Wien Sensation gemacht, sagte man mir. Aber ich kann nicht anders glauben, als daß es höchstens ein paar hundert Weiber zur Orthodoxie zurückgeführt, den Männern aber, wie z. B. uns, mehr Stoff zum Ärger über den Unverstand oder die Böswilligkeit seines Schreibers geliefert habe. Die Ruhe und Objektivität des ersten Bandes ist freilich gefährlich, dafür aber vereitelt der hitzige Eifer und die schroffe Nackheit des dritten bei Menschen seltener Art die gewünschte Bekehrung […] Gutzkow’s Ritter können nach dieser Seite auch nicht befriedigen, aber in ihnen waltet doch ein weit ächterer religiöser Geist als bei dem raufhäuslichen Prediger […]“ Brief 12: Warschau, 23. Mai 1857. „[…] Ich habe inzwischen hier meine Prüfung als deutscher Sprachlehrer gemacht und mich entschlossen noch einige Jahre hier zu bleiben. Meinen letzten kleinen Zögling habe ich nach einigen Monaten einer Gouvernante abgetreten, da er für mich zu klein war und einstweilen bei einem Banquier eine Hofmeisterstelle angenommen in der ich mich ziemlich wohl befinde und recht gut stehe […]“