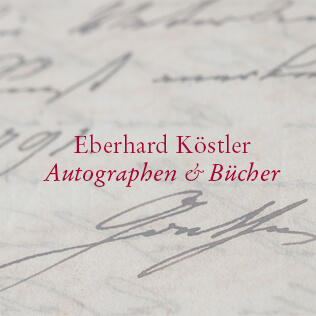Beschreibung
Schluss eines intimen Briefes an die Jugendfreundin Misulka mit zahlreichen Hervorhebungen. Die Anspielungen im Text verweisen auf das Jahr 1901, das sie mit Friedrich Pineles im niederösterreichischen Oberwaltersdorf verbrachte, wo die junge Schwangere nach einem Sturz vom Apfelbaum eine Fehlgeburt erlitt. Über irdische und platonische Liebe, über leibliche und geistige Mutterschaft. Lou Andreas-Salome stellt hier letztlich, kurz nach dem Bruch mit Rilke und dessen „Verbannung“ nach Worpswede im Jahr 1900, die inspirierende Liebe der Muse über die körperliche Liebe, die intellektuelle Schaffenskraft der gleichberechtigten Partnerin über die geschlechtliche Anziehung zwischen Männern und Frauen: „[…] liegt ganz bestimmt in unserm Zustand; ich erlebe es hier oder an mir selbst, ebenso auch eine gewisse wüthende Reizbarkeit – schade, daß Du Deinem ausgeschimpften Schwiegersohn das nicht mitteilen kannst!! Ich bin stets sehr froh, wenn ich dann Jemanden zu fassen kriege, an dem ich diese ‚physiologische‘ Wuth ausbullern kann, denn ich behalte dergleichen für nichts in der Welt gern im Magen. Es fügt sich aber nicht stets so gut, denn es gehört dazu allerlei: man muß Jemanden ziemlich gern haben um das so recht loszuwerden, es ist insofern gewissermaßen nicht ohne Schmeichelei für ihn. – Aber abgesehn davon ist es über-haupt so eine Sache mit dem Leben ‚mit Andren‘ speziell in unserer ‚Verfassung‘; ich weiß nicht, ob es dir auch so geht und ob es vielleicht Mitschuld trug an den Königsberger Schattenseiten; ich kann jetzt ganz plötzlich, obgleich alles stimmt und mich an einem Beisammensein freut, das Ganze momentan nicht mehr mögen, [Einweisung: oder, besser gesagt: nicht mehr in seiner Nothwendigkeit würdigen]. Ich nehme an, es findet da ein Kampf statt zwischen der noch vorhandenen enormen Illusionskraft die zu aller Glücksstimmung gehört, und der Schärfe des Blicks, die zu früh einsetzt. Ehemals trennten die Beiden sich zeitlich bei mir, – ich nahm sogar Dinge ins Bewußtsein auf, die ich mit dieser Blickschärfe später – kritisch oder psychologisch-künstlerisch – verwerthete, aber im Moment des Erlebens schaltete ich sie selbstbewußt aus. Es könnte doch sein, daß Dir jetzt mitten in der Freude an Deinen ‚Kindern‘, Alles Für und Wider, woran es niemals & nirgends fehlte, zu ausführlich zum Bewußtsein käme. Das ist ja wahrscheinlich der Vortheil der ganz tief & körperlich fundirten Verhältnisse wirklicher Mutterschaft oder wirklicher Gattenliebe, daß sie gleichviel wie kritisch gestimmt man sei, nicht absolut in Frage gezogen werden können. Aber dafür, glaube mir, hätten sie auch etwas so kolossal Lastendes, zu Boden Ziehendes in solchen Momenten, weil man sich ihrer letzten Thatsächlichkeit nicht entledigen kann. Genießen kann man nur – das gehört zu meinen unumstößlichen Überzeugungen, – nur, was man mit einem Fuße draußen stehend ausschöpfen kann. Dies ist nämlich der berühmte Punkt um die Welt aus den Angeln zu heben, – der Punkt außerhalb. Alles andere wirkt gelegentlich als Sargdeckel, erdrückt, macht todt. Ich wär sogar von diesem Standpunkt aus für den Jenseitsglauben: um das Diesseits vollaus genießen zu können, – was die Leute, die aufs Diesseits allein gestellt sind, nicht recht zuwege bringen aus eben dieser aufregenden drinfestklebenden Ausschließlichkeit des Verhältnisses. – Wir müssen durchaus das Schöne wahrnehmen, was für uns drin liegt, daß wir mit zarteren Sohlen über die Erde gehn als die Mütter und altmodischen Gattinen. Nur so werden wir auch etwas anderes zu geben haben als sie, – natürlich nichts Werthvolleres, aber doch was Ergänzenderes. Deine platonische Mutterschaft ist was Selteneres als die irdische, denn um sie zu ermöglichen gehören viel seltenere Zufälle zusammen. Grob gesprochen könnte man sagen: von der Menge Samen die in eine weibliche Gebärmutter geräth, wird irgend ein Samenfädchen, je nach seiner besten Lage dort, fruchtbar mit dem Ei; – aber wie ganz anders tief begründet ist es, welch ein Mensch unter den vielen die in unser Bewußtsein gerathen, im platonischen Sinne uns zum ‚Kinde‘ wird. Um genau ebensoviel sind wir der irdischen Mutter über wenn wir sie auch am faktisch Schöpferischen nicht erreichen, so schaffen wir doch durch diesen Punkt etwas, was noch nicht war. Verzeih diese Ergüsse! nicht wahr, ich darf doch sicher sein, daß du sie stets verbrennst? Inniger Schmatz! Deine Lou“. – Wolf Scheller schreibt über die Beziehung zwischen Pineles und Lou Andreas-Salomé: „Schon kurz nach der Trennung von Rilke hatte sie den Kontakt mit Pineles wiederaufgenommen, eine ‚eheähnliche‘ Verbindung, die vorwiegend sexueller Natur war. Nach der ersten Euphorie – so behaupten jedenfalls Ursula Welsch und Michaela Wiesner in ihrer Lou-Biographie – sei ihr der Charakter dieses Verhältnisses klar geworden: ‚Ihr wurde bewußt, daß sie kein Kind von ihm wollte, […] da es für sie offensichtlich unmöglich war, sexuelle und seelische Übereinstimmung in einer Beziehung miteinander in Einklang zu bringen […]‘. Einen Beweis für diese These gibt es nicht. Tatsache ist lediglich, daß Lou Friedrich Pineles in ihrem ‚Lebensrückblick‘ mit keinem Wort erwähnt. Ernst Pfeiffer, der Herausgeber ihres Nachlasses, berichtet, sie habe sich dieser Beziehung in gewisser Weise geschämt.“ – Wolf Scheller, Die Mitdenkerin. Ein Porträt der Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé, Heidelberg 2010, S. 8. – Klammerspur am Oberrand.